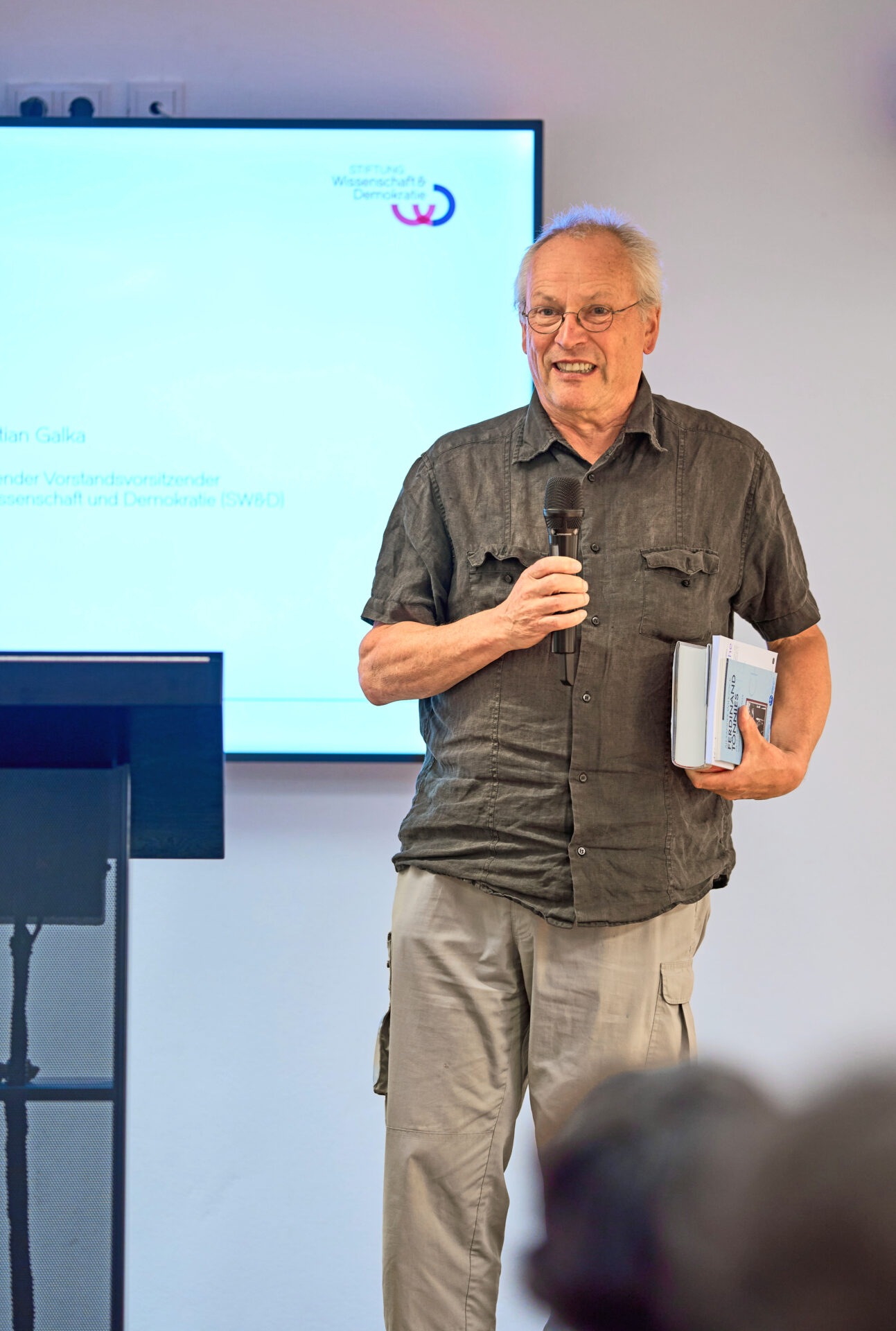Bericht zum Vortrag von Alexander Wierzock
Wie aktuell kann ein Denker von gestern sein?
Was hat ein nordfriesischer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert der heutigen Gesellschaft zu sagen – einer Gesellschaft, die sich mit Fake News, politischer Polarisierung und einem schwindenden Vertrauen in Wissenschaft konfrontiert sieht? Eine ganze Menge, wie die Veranstaltung „170 Jahre Ferdinand Tönnies“ am 22. Juli 2025 in der Stiftung Wissenschaft und Demokratie eindrucksvoll zeigte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Julia Jamila Werner.
Zwischen historischen Einsichten und aktuellen Debatten wurde deutlich: Tönnies war nicht nur ein Pionier der Soziologie, sondern auch ein politischer Visionär. Seine Gedanken zur Rolle der Wissenschaft in der Politik, zur empirischen Sozialforschung und zur Reform der Staatswissenschaften wirken erstaunlich modern – und gerade deshalb lohnt sich ein zweiter Blick auf sein Werk.
Zwischen Gelehrtentum und Gesellschaftskritik
Ferdinand Tönnies war vieles: Philosoph, Soziologe, politisch engagierter Bürger – und ein Denker, der sich ungern in feste Kategorien pressen ließ. In seinem Vortrag zeichnete der Historiker Alexander Wierzock vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) das facettenreiche Porträt eines Menschen, der schon im Kaiserreich davon überzeugt war, dass Wissenschaft mehr ist als bloße Theorie: nämlich ein Werkzeug, um die Gesellschaft zu verstehen – und sie zu gestalten.
Mit seiner berühmten Unterscheidung zwischen „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ schuf Tönnies nicht nur einen Klassiker der Soziologie, sondern einen Deutungsrahmen, der bis heute für Diskussionen sorgt. Doch es blieb nicht bei der Theorie: Tönnies engagierte sich in mehreren demokratischen Parteien seiner Zeit – von der Freisinnigen Volkspartei bis zur Sozialdemokratischen Partei – und dachte konsequent darüber nach, wie Politik wissenschaftlich fundiert werden könnte.
Dabei war ihm eines besonders wichtig: die Unabhängigkeit der Politikwissenschaft. In einer Zeit, in der diese noch fest im Kanon der Staatswissenschaften verankert war, forderte Tönnies mutig deren Ausdifferenzierung – eingebettet in ein neues Verständnis von Kultur- und Sozialwissenschaft. Er plädierte für eine Wissenschaft, die nicht nur analysiert, sondern auch Orientierung gibt.
Soziographie – die unterschätzte Schwester der Soziologie
Ein besonderer Fokus der Veranstaltung lag auf einem weniger bekannten, aber nicht weniger spannenden Teil seines Werkes: der Soziographie. Für Tönnies war sie nicht etwa ein Nebenprodukt der Soziologie, sondern ihre „ebenbürtige Schwester“ – eine empirisch arbeitende Disziplin, die konkrete soziale Wirklichkeiten sichtbar macht. Während die Soziologie Theorien formuliert, sollte die Soziographie Daten liefern, Zustände beschreiben und Entwicklungen erfassen.
Dieser Zugang wirft Fragen auf, die auch heutige Sozialwissenschaften umtreiben: Wie viel Nähe braucht Wissenschaft zur Wirklichkeit? Wie objektiv können wir Gesellschaften beobachten – und wie sehr müssen wir uns dabei auch auf das einlassen, was Menschen tatsächlich erleben?
Wissenschaft als politisches Projekt
Vielleicht am eindrucksvollsten war Tönnies’ Idee einer „wissenschaftlichen Politik“: eine Vorstellung, die heute beinahe utopisch anmutet – und doch hochaktuell ist. Politik, so seine Überzeugung, sollte sich nicht von Meinungen, sondern von Erkenntnissen leiten lassen. Gesetze sollten nicht aus dem Bauch heraus entstehen, sondern aus rationaler Analyse gesellschaftlicher Bedürfnisse. In seinen Worten: Der Staatsmann solle „mit derselben Sicherheit und Gewissheit wie der Arzt erkennen, was notwendig, was richtig und heilsam ist“.
Diese Vision bot Stoff für eine lebhafte Diskussion. Kann eine demokratische Gesellschaft wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage regiert werden? Wo liegen die Chancen, wo die Risiken einer solchen Idee – insbesondere in Zeiten politischer Fragmentierung und wachsender Wissenschaftsskepsis?
Ein Blick zurück – mit Zukunft
Die Veranstaltung „170 Jahre Ferdinand Tönnies“ war mehr als nur eine akademische Würdigung. Sie war ein lebendiger Beweis dafür, wie fruchtbar die Auseinandersetzung mit einem scheinbar historischen Denker auch heute sein kann. Tönnies’ Werk wurde nicht museal präsentiert, sondern als intellektuelles Werkzeug, um die Gegenwart zu durchdenken.
Die Teilnehmer*innen diskutierten kontrovers und mit spürbarer Neugier: über die Rolle empirischer Forschung in politischen Entscheidungsprozessen, über die Verantwortung von Wissenschaft in einer sich wandelnden Gesellschaft, über die Frage, was es heute eigentlich heißt, „vernünftig“ zu handeln und über die Spannungsfelder die auch Tönnies‘ Denken prägten.
Am Ende blieb der Eindruck, dass Ferdinand Tönnies auch heute noch in Debatten über Demokratie, Sozialforschung und die Macht des Wissens ein elementarer Bestandteil ist. Sein Ruf nach einer wissenschaftlich fundierten Politik ist heute vielleicht dringlicher denn je.
Impressionen vom Vortrag